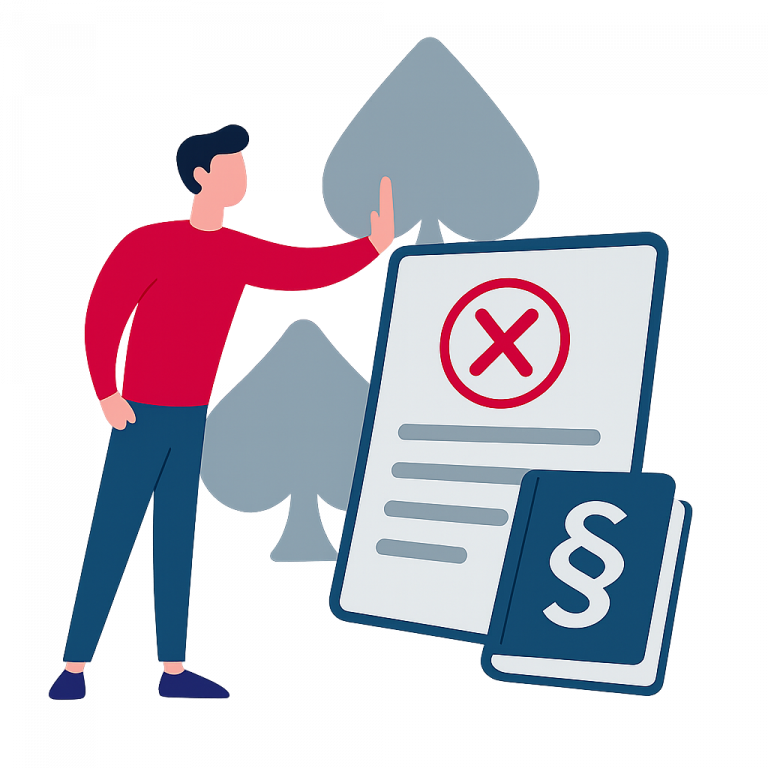Vergewaltigung mit K.O.-Tropfen: Wie ist die Rechtslage?

Unsichtbare Substanzen, schwerwiegende Folgen
Immer wieder wird über den heimlichen Einsatz von K.O.-Tropfen in Bars oder auf Partys berichtet. Die Substanzen werden unbemerkt in Getränke gemischt, um anschließend weitere Straftaten – vor allem aus dem Bereich der Sexualdelikte – zu begehen. Diese Taten sind schwer nachzuweisen und bringen die Betroffenen oft in eine belastende, hilflose Lage. Viele erstatten keine Anzeige – sei es aus Scham, Unsicherheit oder fehlender Erinnerung. Entsprechend ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.
Auch für die Strafverfolgung stellen sich dabei entscheidende Fragen: Wie ist der Einsatz von K.O.-Tropfen rechtlich einzuordnen, insbesondere im Zusammenhang mit Sexualstraftaten wie einer Vergewaltigung? Gelten K.O.-Tropfen strafrechtlich als „gefährliches Werkzeug“? Hiermit hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) kürzlich zu befassen.
Was sind K.O.-Tropfen und was macht sie so gefährlich?
Immer wieder machen Fälle Schlagzeilen, in denen Menschen Opfer von sexueller Gewalt wurden nachdem sie zuvor mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt wurden. Hinter diesem Begriff verbergen sich hochwirksame, sedierende Substanzen wie GHB (auch bekannt als „Liquid Ecstasy“) oder Flunitrazepam.
Das Gefährliche daran ist, dass diese Substanzen sowohl farb- als auch geruchlos sind und damit unbemerkt in Getränke oder Speisen gemischt werden können. Bereits innerhalb weniger Minuten nach der Einnahme treten bei den Opfern verschiedene Symptome auf, vor allem starke Müdigkeit, Orientierungslosigkeit, Bewusstlosigkeit sowie Gedächtnislücken.
Opfer verlieren die Kontrolle über ihren Körper und ihren Willen – und damit auch die Fähigkeit, sexuelle Handlungen abzulehnen oder sich gegen jegliche Art von Übergriffen zu wehren. Der Einsatz solcher Substanzen zielt bewusst darauf ab, den freien Willen auszuschalten und stellt somit einen massiven Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung dar.
Wie ist die Rechtslage?
Die Vergewaltigung ist im Rahmen des § 177 StGB geregelt und stellt dort einen besonders schweren Fall dar. Von einer Vergewaltigung spricht man, wenn jemand eine andere Person gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr oder zu anderen erniedrigenden sexuellen Handlungen zwingt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es zu einem Eindringen in den Körper des Opfers kommt.
Wer eine Vergewaltigung begeht, muss mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren rechnen.
K.O.-Tropfen als „gefährliches Werkzeug“?
Eine deutlich höhere Strafandrohung ist insbesondere dann vorgesehen, wenn eine Vergewaltigung unter Einsatz einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs begangen wird. In solchen Fällen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren.
Liegen bestimmte erschwerende Umstände vor, sieht das Gesetz sogenannte Qualifikationstatbestände vor. In diesen Fällen wird automatisch ein höherer Strafrahmen angesetzt als beim Grundtatbestand.
Unter den Begriff der Waffe fallen solche Gegenstände, die im technischen Sinne als Waffen gelten und entsprechend im Waffengesetz erfasst sind. Schwieriger ist hingegen die Einordnung beim Tatbestandsmerkmal des gefährlichen Werkzeugs. Hier sind Abgrenzung und Auslegung oftmals problematisch – so auch in einem Fall, mit dem sich der Bundesgerichtshof kürzlich befasst hat.
Konkret ging es darum, ob K.O.-Tropfen, die oft bei Vergewaltigungen zum Einsatz kommen, ein gefährliches Werkzeug im Sinne des Strafrechts darstellen. Die Vorinstanz hatte dies bejaht und den Qualifikationstatbestand als erfüllt angesehen. Der BGH widersprach jedoch dieser Bewertung.
Dennoch kann dem Täter eine höhere Strafe drohen, etwa dann, wenn das Opfer nach der Einnahme von K.O.-Tropfen in konkrete Lebensgefahr gerät, z. B. durch Bewusstlosigkeit und einer dadurch erhöhten Erstickungsgefahr.
K.O.-Tropfen kein Werkzeug im Rechtssinne
Nach Auffassung des BGH fehlt es bei K.O.-Tropfen an der spezifischen Einwirkungsmöglichkeit, die ein Werkzeug gerade auszeichnet. Zur Verdeutlichung: Werkzeuge – etwa ein Hammer oder eine Bohrmaschine – entfalten ihre Wirkung durch gezieltes menschliches Einwirken. Es handelt sich um eine Art Zusammenwirken von Mensch und Gegenstand, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
Bei K.O.-Tropfen fehlt es hingegen an dieser Form der Einwirkung. Ihre Wirkung entfaltet sich vielmehr selbstständig nach der Verabreichung. Würde man sie dennoch als gefährliches Werkzeug einstufen, würde man das allgemeine Verständnis eines Werkzeugs überdehnen und damit gegen grundlegende strafrechtliche Prinzipien verstoßen.
Unabhängig davon stellt die Verabreichung von K.O.-Tropfen auch eine gefährliche Körperverletzung nach § 224 Abs. 1 Nr. 1 StGB dar, da die Substanz beim Opfer regelmäßig erhebliche gesundheitsschädigende Wirkungen hervorruft.

Wir konnten bisher bundesweit mehr als 50.000 Menschen bei ihren rechtlichen Anliegen helfen.
Bei uns warten Sie nicht auf einen Beratungstermin, sondern erhalten Ihre Einschätzung sofort.
Unsere Kundschaft hat unsere Beratung und unseren Einsatz bewertet – das Ergebnis macht uns stolz.
Vergewaltigung mit K.O.-Tropfen: Warum sich die Strafverfolgung oft als schwierig erweist
Die strafrechtliche Aufarbeitung von Fällen, in denen mutmaßlich K.O.-Tropfen eingesetzt wurden, ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Das größte Problem besteht in der extrem kurzen Nachweisbarkeit der Substanzen, denn viele der verwendeten Mittel sind bereits wenige Stunden nach der Einnahme im Blut nicht mehr nachweisbar. Eine effektive Spurensicherung ist also nur möglich, wenn sehr frühzeitig eine medizinische Untersuchung erfolgt. Ist kein Nachweis von K.O.-Tropfen möglich und kann sich das Opfer nur lückenhaft an die Tat erinnern, ist es für die Ermittlungsbehörden oft schwer, ausreichend belastbare Anhaltspunkte für eine Anklage zusammenzutragen.
Erschwerend kommt hinzu, dass es vor Gericht häufig zu Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen kommt. Betroffene sehen sich dann nicht selten dem Vorwurf ausgesetzt, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Nachhinein als Übergriff darzustellen. Da K.O.-Tropfen das Erinnerungsvermögen stark beeinträchtigen oder ganz auslöschen können, ist eine detaillierte Schilderung der Tat für viele Opfer kaum möglich – was die Beweisführung zusätzlich erschwert.
In der rechtspolitischen Debatte wird seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob der Einsatz von K.O.-Tropfen – besonders bei Sexual- und Raubdelikten – strenger bestraft werden sollte.
Entsprechende Forderungen – etwa eine gesetzliche Klarstellung oder Anhebung des Strafrahmens – sind bislang aber nicht umgesetzt worden.

Häufig gestellte Fragen